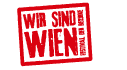15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus
Der 15. Bezirk zählt zu den kleinen Bezirken der Stadt. Der Name Rudolfsheim ist dem Kronprinz Rudolf gewidmet, Fünfhaus geht auf fünf Winzerhäuser zurück, die um 1700 im Bereich der heutigen Clementinengasse entstanden. Heute merkt man wenig von einer vergangenen Winzer- und Heurigentradition. Lediglich das Schutzhaus Zukunft, populäres Zentrum mitten im Kleingartengebiet des 15. Bezirks, erinnert noch ländliches Leben und an urige Heurigengärten. Geprägt und durchschnitten ist der 15. Bezirk durch die Westbahn, die auch zur Industrialisierung des Bezirks beitrug sowie zur Ansiedlung von Hotels und Einkehrgasthöfen. Ab 1857 als Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof erbaut, ist der Westbahnhof mittlerweile zur „Bahnhofs-City“ mutiert, Shopping Mall inkludiert. Der 15. Bezirk ist ein zentraler, urbaner Bezirk und im Moment „im Kommen“ hat man den Eindruck. Vielleicht auch deshalb, weil die Wohnungspreise im Vergleich zum bereits „hippen“ Nachbarbezirk Ottakring noch um vieles leistbarer sind.
Zur Geschichte im Detail:
Der Vorort Rudolfsheim entstand am 4. Dezember 1863 durch die Vereinigung der bis dahin selbstständigen Ortsgemeinden Braunhirschengrund, Reindorf und Rustendorf. Zu Ehren des damals fünf Jahre alten Kronprinzen Rudolf wählte man den Namen Rudolfsheim. Am 1. Jänner 1892 wurden die beiden Vororte Rudolfsheim und Sechshaus zum 14. Bezirk Rudolfsheim zusammengefasst, der Vorort Fünfhaus wurde zum 15. Wiener Gemeindebezirk erhoben. Am 15. Oktober 1938 wurden diese beiden Bezirke zum neuen 15. Wiener Gemeindebezirk vereinigt. Dieser Bezirk wurde am 15. Februar 1957 in „Rudolfsheim-Fünfhaus“ umbenannt.
Frühjahrsparade auf der Schmelz
Das Areal des Bezirks reicht von der Schmelz bis hinunter an den Wienfluss, und noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts war dieses Gebiet fast vollkommen unbesiedelt. Erst im 18. und 19. Jahrhundert kam es zu einer intensiven Bebauung, vor allem entlang der Mariahilfer Straße, an der sich Einkehrgasthöfe und kleine Gewerbebetriebe installierten, die als Zulieferbetriebe für die Industrie innerhalb der Linie arbeiteten. Im Vorort Rudolfsheim entstand nach 1869 durch Parzellierung zwischen Westbahn und Hütteldorfer Straße der neue Ortsteil "Neu-Rudolfsheim". Die Schmelz war eine viele Jahrhunderte lang unverbaute Wiesenfläche, teils auch Ackerland. 1847 kaufte das Ärar einen Teil des Areals auf und gründete hier einen Exerzierplatz, auf dem u. a. die berühmten Frühjahrsparaden abgehalten wurden. Der südliche und östliche Teil der Schmelz wurde 1910 parzelliert und verbaut ("Neu-Fünfhaus", "Nibelungenviertel"). Den Rest des Gebietes nimmt heute die 1953-1958 von Roland Rainer erbaute Stadthalle, das Universitätssportzentrum und eine Kleingartenanlage ein.
"Schwenders Vergnügungsetablissement"
Reindorf, eine selbstständige Vorortgemeinde, zwischen den Ortschaften Sechshaus, Braunhirschengrund und Fünfhaus angesiedelt, wird bereits 1344 in den Quellen erwähnt ("in der Rhein"). Seit 1411 findet sich der Name Reindorf für die Siedlung, die nach der Zweiten Türkenbelagerung zugrunde ging. Erst im 18. Jahrhundert blühte sie neu auf. 1801 wurde die Gemeinde durch Veränderungen der Grenzen stark verkleinert. Eine Reihe von Gründen und Häusern gelangte an Franz Freiherrn von Mayer, der damals die Herrschaft Penzing besaß, und auch die Nachbargemeinde Sechshaus erhielt einige Häuser. 1696 errichtete Josef Christoph von Plankenau im Ortsgebiet von Reindorf einen Herrschaftssitz, in dessen Nachbarschaft ein Gasthaus "Zum braunen Hirschen" entstand. Mit der Zeit entwickelte sich daraus die Ortsbezeichnung Braunhirschengrund. Der Grund wurde 1799 parzelliert und verbaut. So entstand die Gemeinde Braunhirschen, die 1801 von Reindorf getrennt wurde.
Das Sommerpalais der Erzherzogin Marie Christine, einer Tochter Maria Theresias, auf dem Braunhirschengrund wurde nach ihrem Tod von dem Bankier Nathan Arnstein erworben, dem Teilhaber des Großbankhauses Arnstein & Eskeles, das dreißig Jahre lang das Finanzwesen Österreichs mitbestimmte. Nathans brillante Gattin Fanny führte einen literarischen Salon, in dem sich Größen von Kunst, Literatur und Finanz zu gesellschaftlichen Soireen trafen. 1849 errichtete der Direktor des Theaters an der Wien, Franz Pokorny, im Garten dieses Palais das Braunhirschentheater. 1861 wurde das Theater aufgelassen, und das Etablissement Schwender erwarb die Liegenschaft. Die übrigen Arnstein´schen Besitzungen gingen 1868 in den Besitz der Gemeinde Rudolfsheim über, die sie parzellieren und verbauen ließ. "Schwenders Vergnügungsetablissement" war einer der berühmtesten Treffpunkte der Wiener im 19. Jahrhundert. Der umfangreiche Gebäudekomplex an der Mariahilfer Straße, beim heutigen Schwendermarkt, wurde 1898 demoliert. Eine Reihe von Zinshäusern trat an seine Stelle.
Die Gemeinde der Einkehrgasthöfe
Die Ortsgemeinde Rustendorf, nach 1700 erstmals genannt, und zwar als "Rustendörfel", bestand um 1771 erst aus fünf Häusern. Sie lag am Ende der heutigen Mariahilfer Straße gegenüber dem Braunhirschenmarkt, dem heutigen Schwendermarkt. Rustendorf war Eigentum der Freiherren von Mayer, die den Ort mit der Herrschaft Penzing 1843 dem Schottenstift verkauften. Trotz der geringen Anzahl an Häusern war die Siedlung recht wohlhabend, weil sich hier viele Einkehrgasthöfe befanden, darunter der "Reichsapfel", der "Schwarze Adler" und die "Goldene Sonne". Sie entstanden alle in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Bautätigkeit auf dem freien Gelände zwischen Rustendorf und Braunhirschengrund besonders stark an, und die beiden Siedlungen wuchsen zusammen.
Fünf Winzerhäuser sind namensgebend
Die Ortsgemeinde Fünfhaus, außerhalb des Linienwalls links und rechts der heutigen Mariahilfer Straße gelegen und bis zur Sechshauser Straße reichend, entstand um 1710 im Bereich der heutigen Clementinengasse, wo in der Ried "In den hangenden Lüssen", die dem Barnabitenkolleg der Michaelerkirche gehörte, fünf Winzerhäuser errichtet wurden. Sie gaben der späteren Gemeinde Fünfhaus ihren Namen. Die "hangenden Lüssen" waren langgestreckte Streifen von Weingärten, die von der Schmelz herab bis zum Wienfluss führten. Bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm Fünfhaus einen raschen Aufschwung. 1795 zählte der Ort bereits 55, 1858 wies er schon 238 Häuser auf. Dementsprechend dehnte sich das Siedlungsgebiet auch nördlich der heutigen Mariahilfer Straße aus, die ursprünglich die Gemeindegrenze gebildet hatte. Im Vormärz kam es zu einer ersten Industrialisierungswelle. Nach dem Bau der Westbahn entstand nördlich der Bahntrasse der Ortsteil Neu-Fünfhaus. der sich durch seine klare Rastergliederung deutlich vom alten Ortskern abhebt. 1849 wurde Fünfhaus zu einer selbstständigen Gemeinde erhoben und zählte bald zu den angesehensten Vororten Wiens. Der Bau der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn, wie sie ursprünglich hieß, brachte einen weiteren Aufschwung. So entstanden eine Reihe von Hotels für ankommende Bahnreisende, vor allem auch in dem Ortsteil jenseits des Linienwalls, der 1905 an den 7. Bezirk abgetreten wurde (zwischen Mariahilfer Straße und Burggasse bzw. Wimbergergasse und Kenyongasse).
Das Dorf der „sechs Häuser“
Im 18. Jahrhundert entstand südlich der heutigen Sechshauser Straße ein winziges Zeilendorf, das vorerst aus sechs Häusern bestand, von denen das erste direkt am Liniengraben der Gumpendorfer Linie lag. Obwohl die 1801 durch Eingliederung eines Teiles von Reindorf vergrößerte Gemeinde 1830 bereits 134 Häuser zählte, blieb ihr der Name Sechshaus erhalten. Die Siedlung erlitt jedoch immer wieder verheerende Rückschläge, so durch die zweimalige französische Belagerung 1805 und 1809 und durch die Choleraepidemie von 1832 und die Typhuswelle 1845. Dennoch entwickelte sich die kleine Gemeinde verhältnismäßig gut zu einem gewerblichen und frühindustriellen Gemeinwesen.
Rudolfheim-Fünfhaus heute
Der heutige 15. Bezirk wird begrenzt durch die Straßenführungen Winckelmannstraße, Linzer Straße, Fenzlgasse, Beckmannstraße, Hütteldorfer Straße, die Schmelz, die Gablenzgasse, den Neubaugürtel, den Mariahilfer Gürtel und die Linke Wienzeile. Er wird durchschnitten durch die Trassenführung der Westbahn, die allerdings durch zwei Brücken, die Schmelzbrücke und den Rustensteg, überbrückt wird. Einige Areale des Bezirks sind potentielle Sanierungsgebiete. Der Bezirk ist im Großen und Ganzen überaus verkehrsreich und arm an Grünflächen.